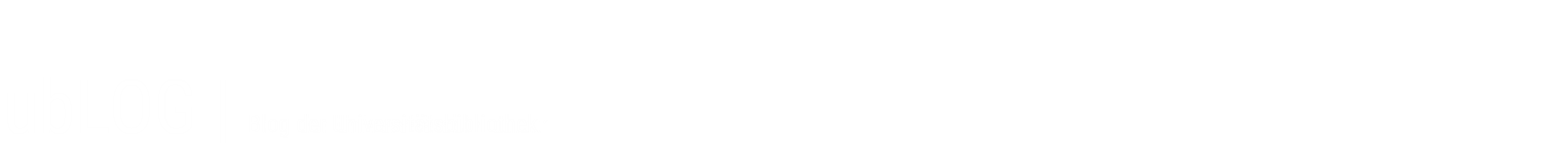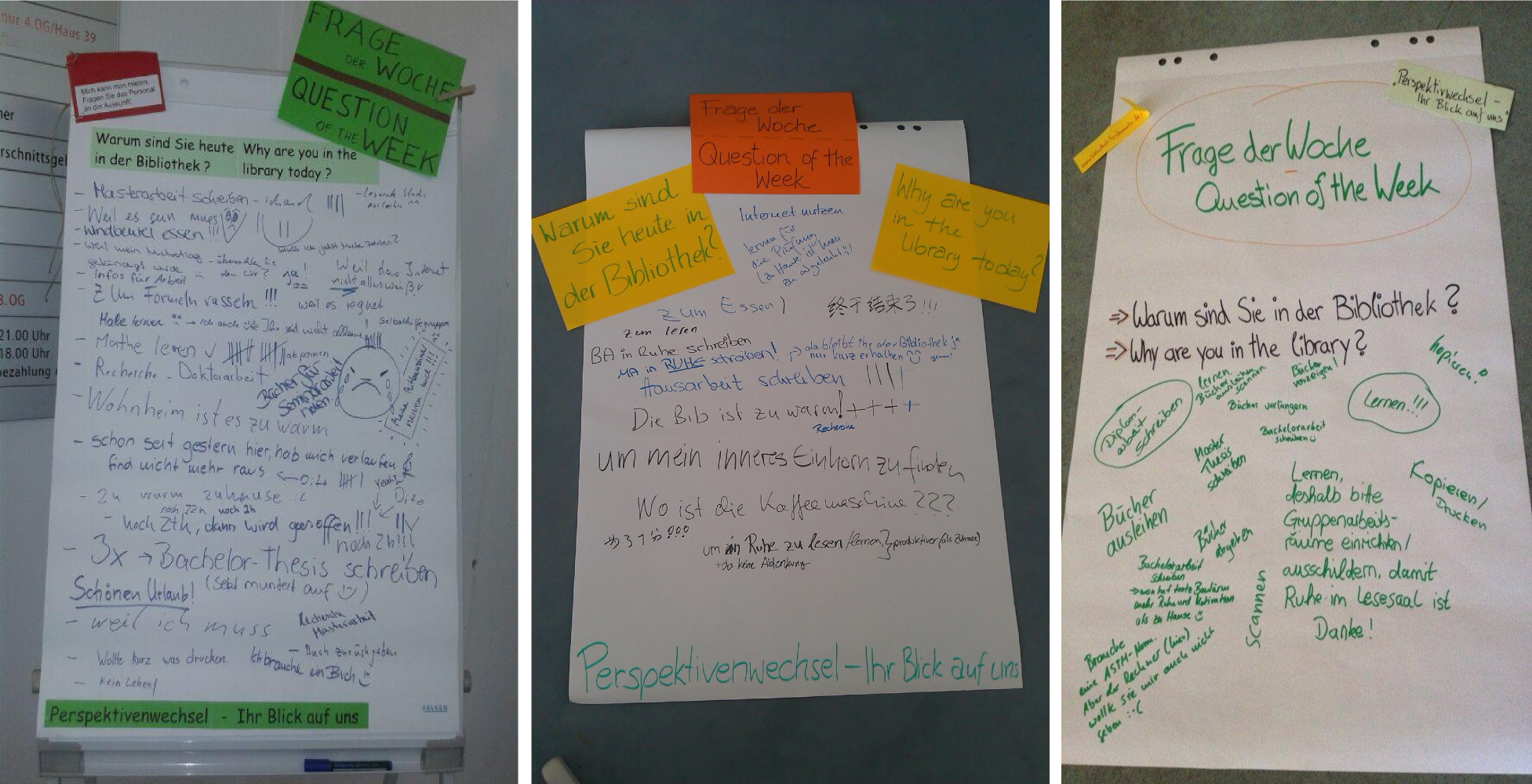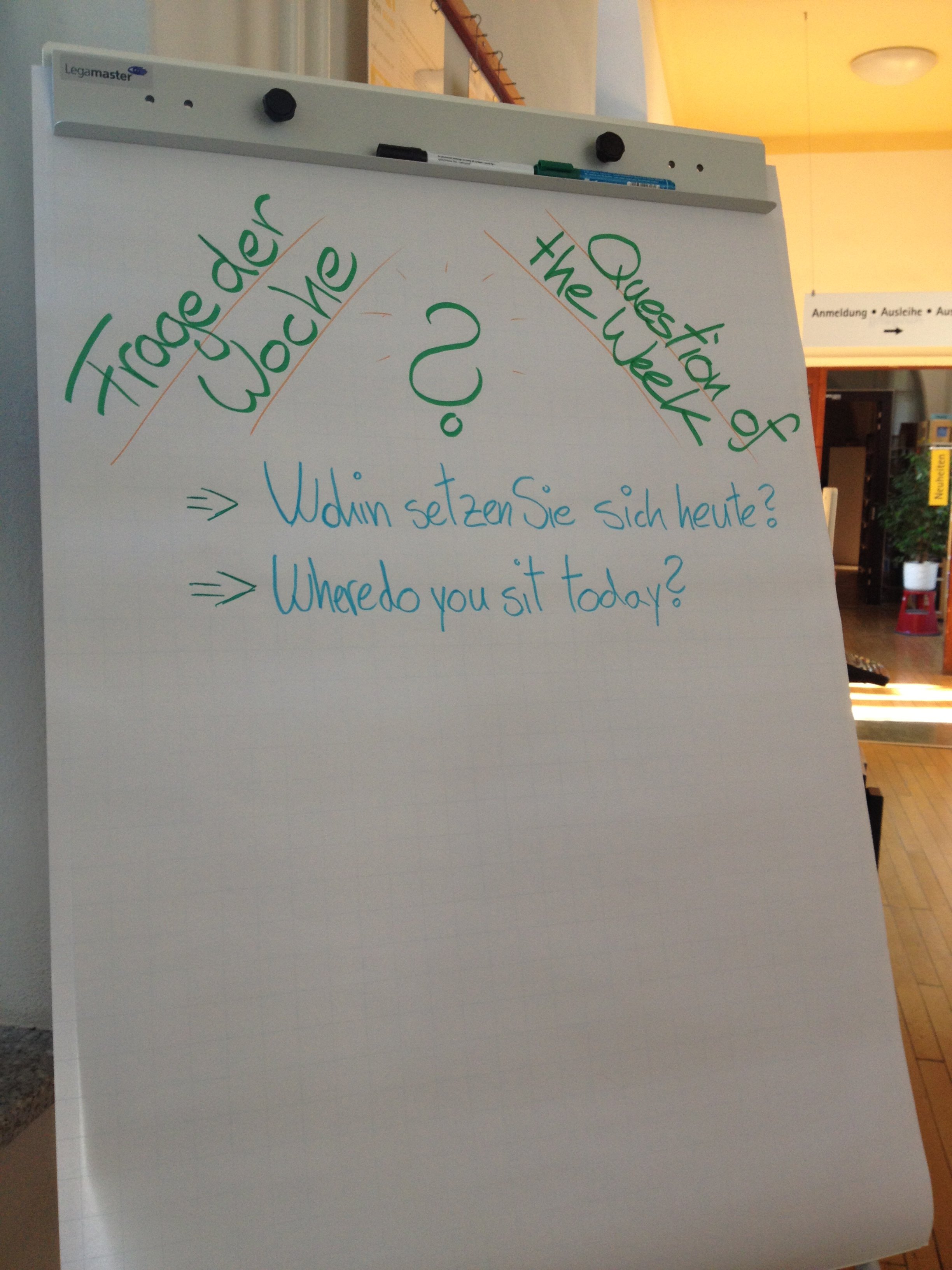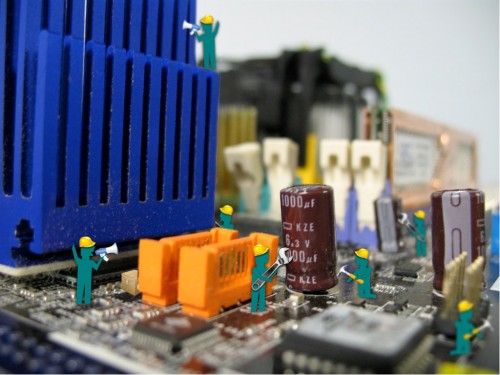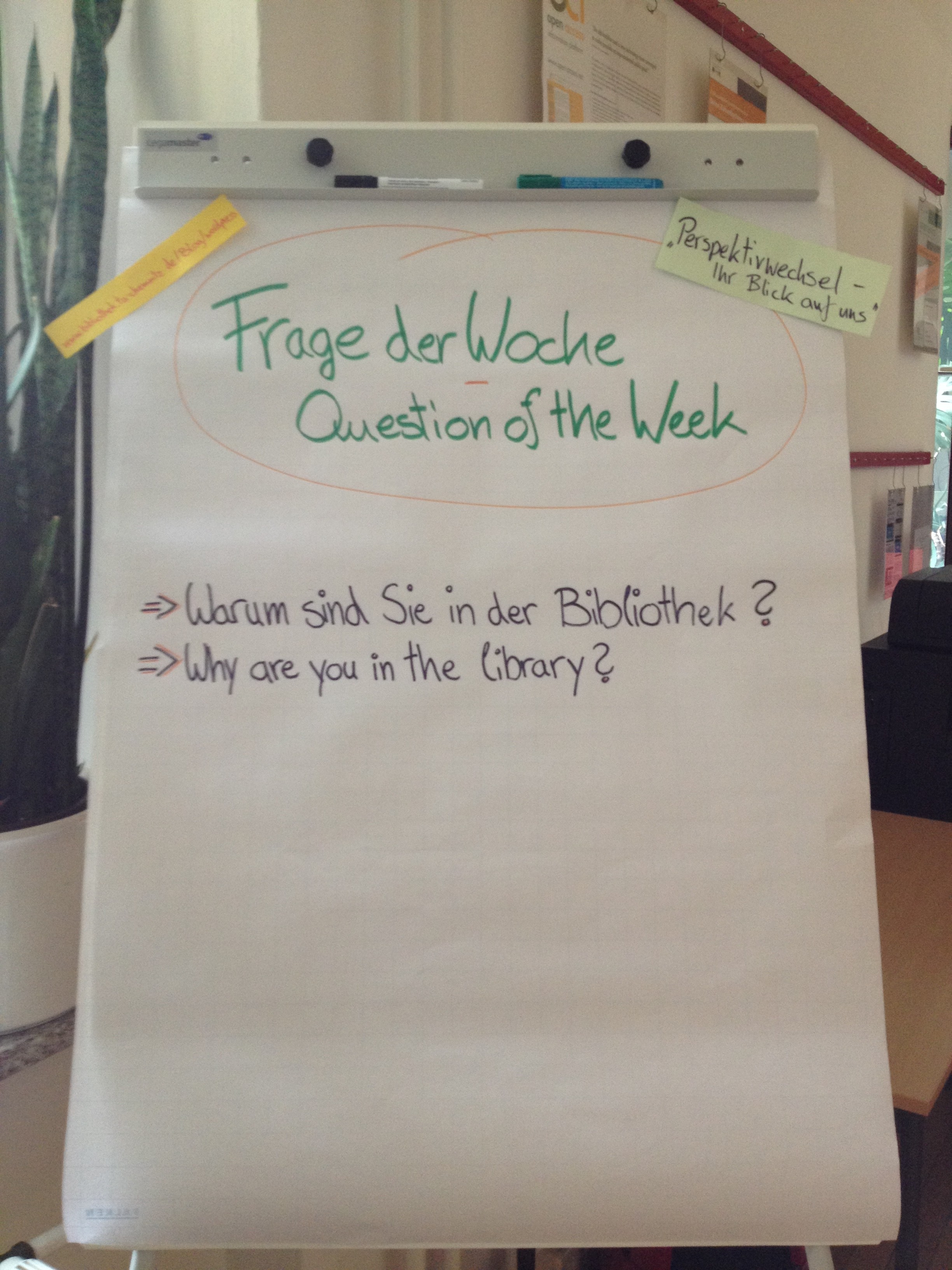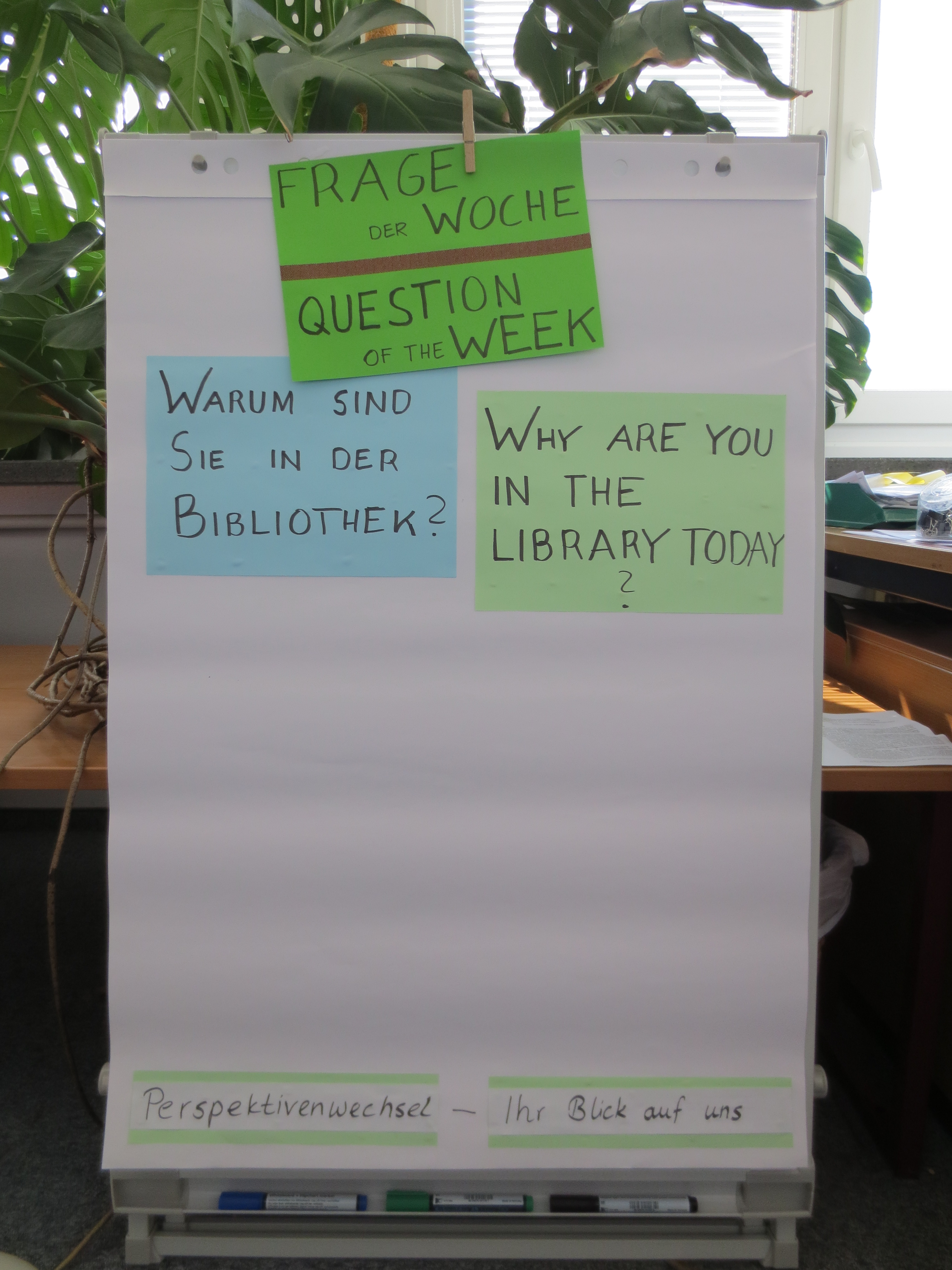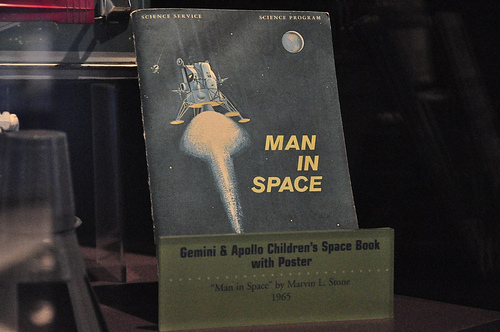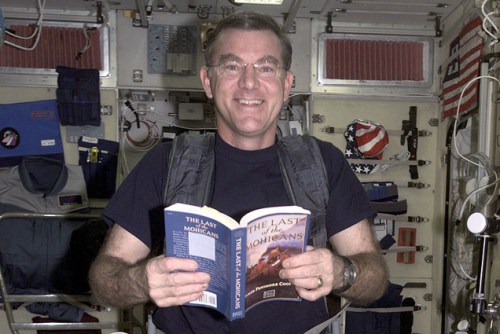Liebe Bloggerin, lieber Blogger,
in wenigen Tagen ist es soweit und das preisgekrönte OER-Projekt L3T geht in die zweite Runde.
In 7 Tagen, genauer gesagt vom 20. bis zum 28.August 2013, wird das Lehrbuch für Lehren und Lernen mit Technologien vollständig überarbeitet und ergänzt. Die Herausgeber wollen das Projekt in 8 L3T-Camps in Deutschland und Österreich, mit rund 200 Mitwirkenden und mit den Möglichkeiten der Online-Kommunikation stemmen.
Beispielsweise sorgen tägliches L3T TV sowie eine mobile Reporterin, die rund 4.000 km zurück legt, um alle Camps in sieben Tagen zu besuchen, für einen Austausch über den Stand des Projekts.
L3T-Camp nennen wir die regionalen Anlaufstellen für potentielle Mitmacher/innen, die L3T nicht nur vom Arbeitsplatz oder zuhause unterstützen wollen.
Nicht nur Autor/innen, sondern alle die das Projekt unterstützen wollen – beispielsweise zum korrigieren, layoutieren, formatieren, fotografieren oder für PR. Hier werden Arbeitsmöglichkeiten für min. 10 Personen, W-Lan, nette Kontakte sowie Kaffee geboten.
Natürlich muss man nicht zu einem Camp fahren um mitzumachen – aber spätestens das gemeinsame Anstoßen am 7. Tag macht doch dann „in echt“ mehr Spaß!
Informationen für Blogger/innen:
Übersichtsseite in Google Drive für alle Blogger/innen
Den Weblog zu L3T 2.0
Die Storify-Seite für’s Blogging rund um L3T 2.0