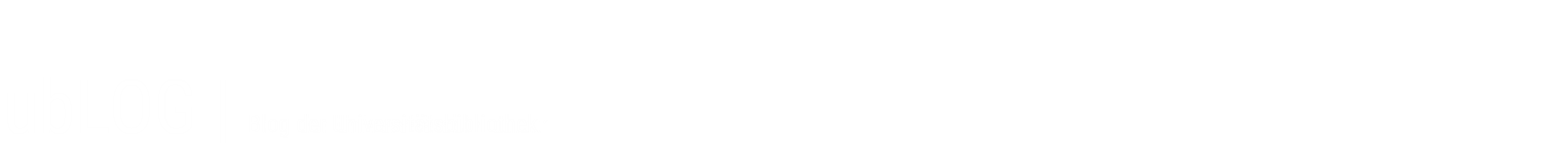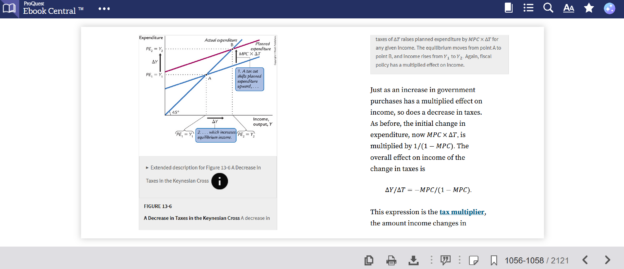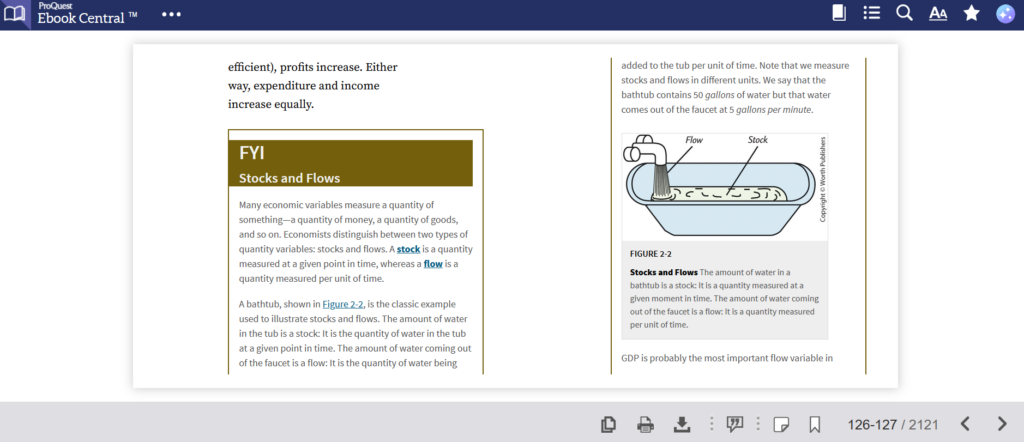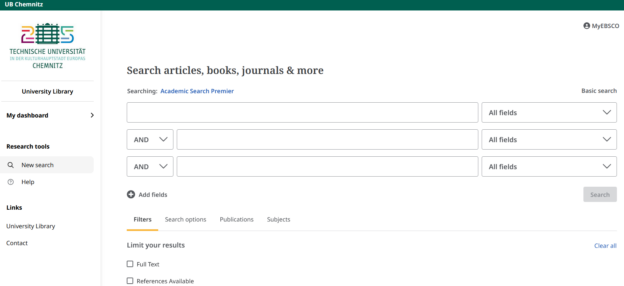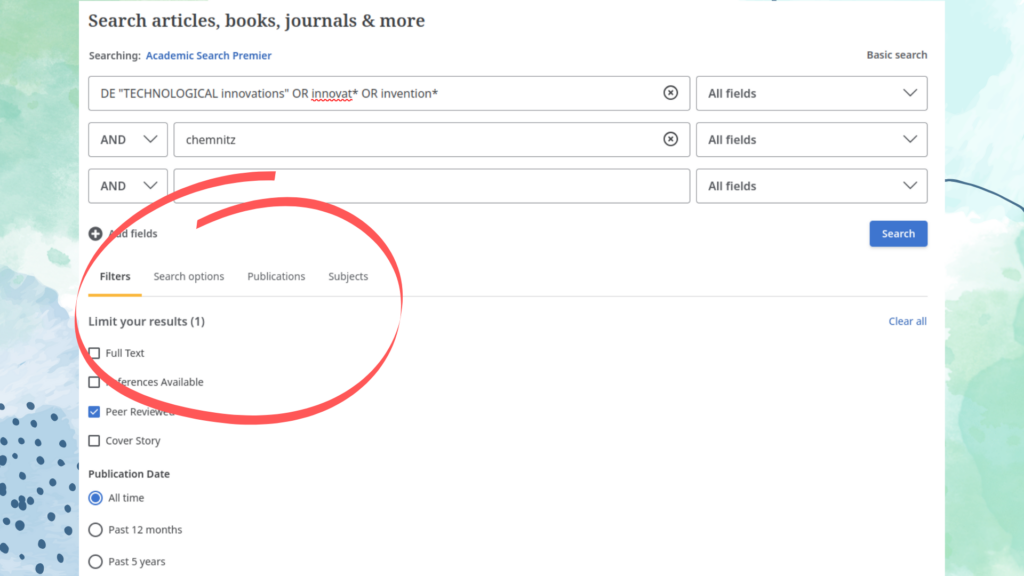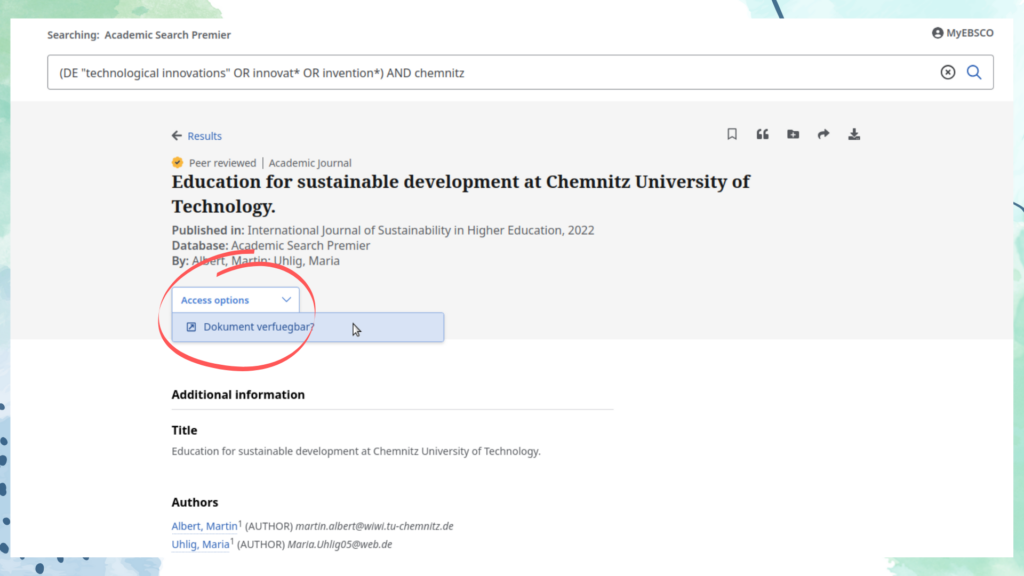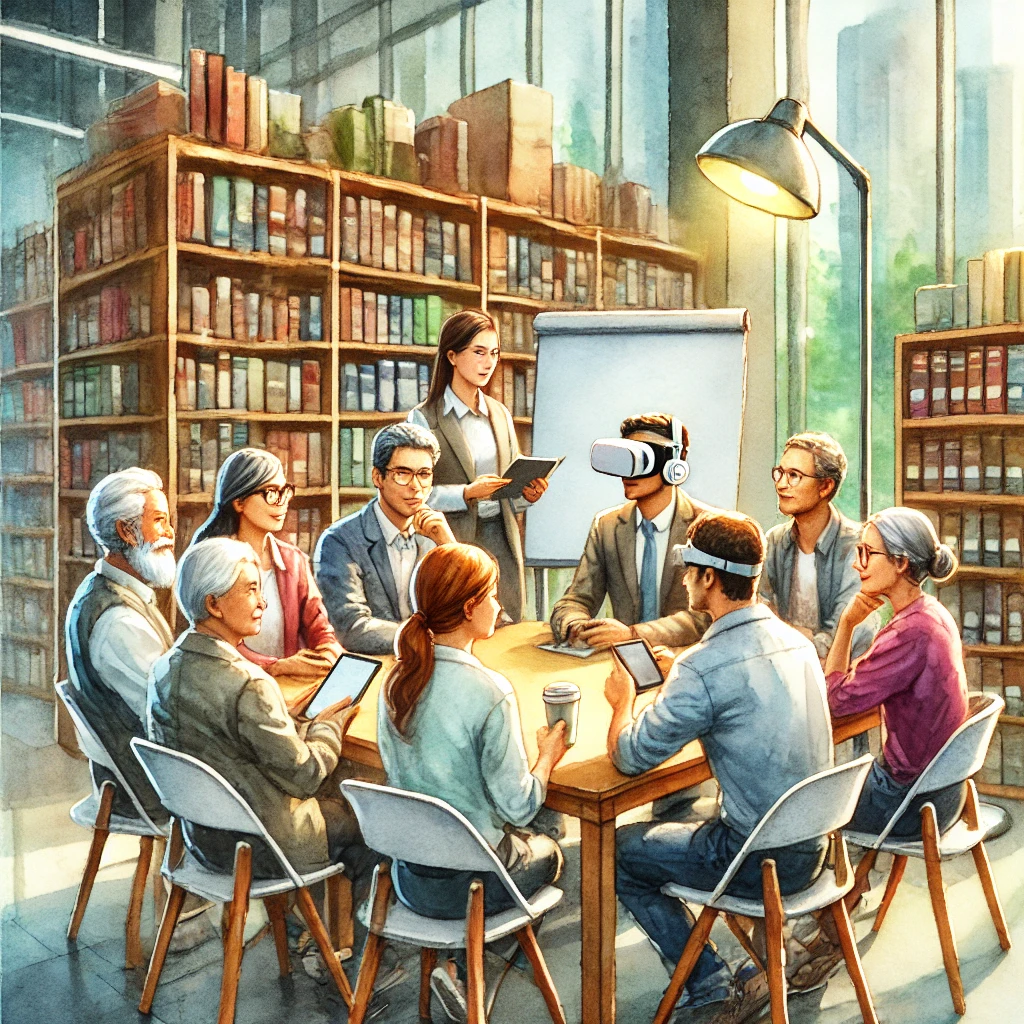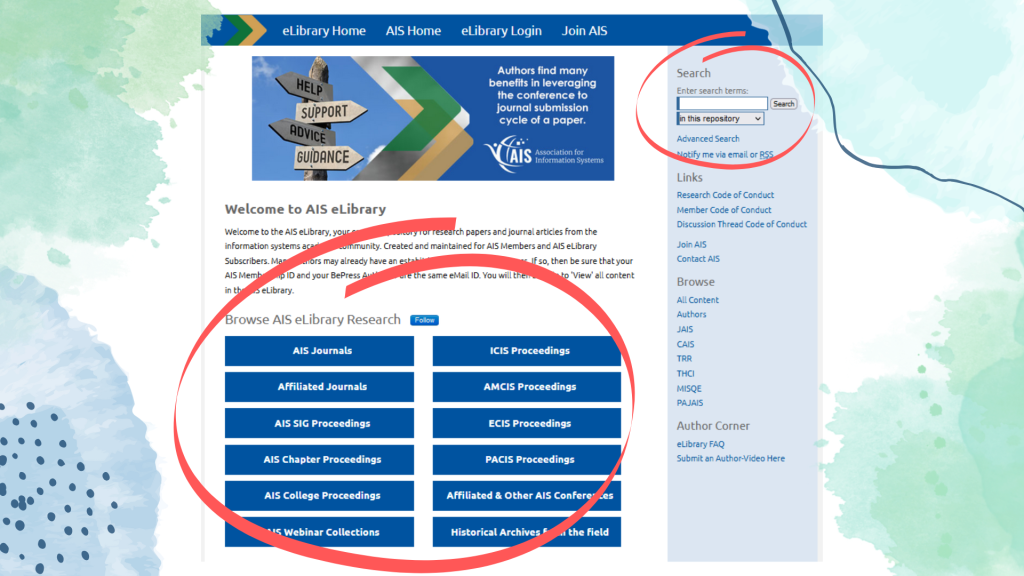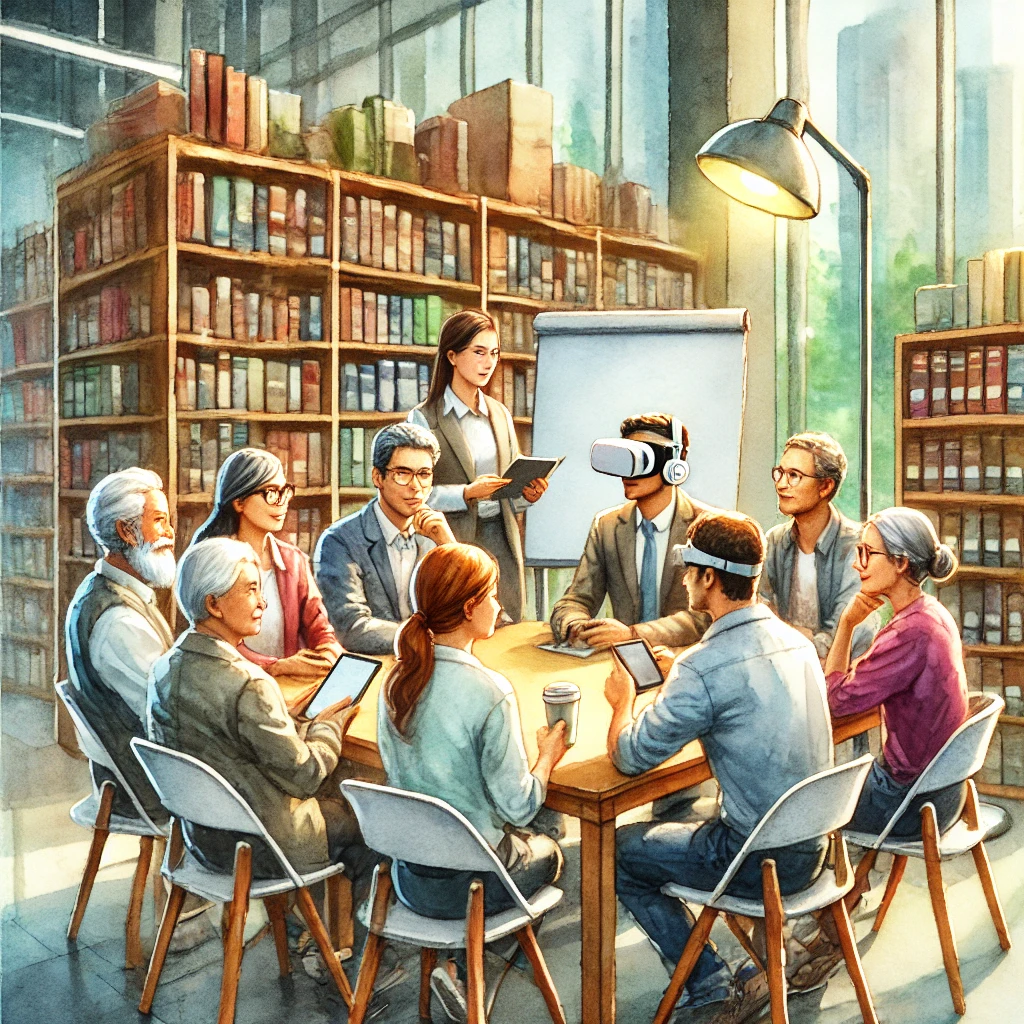
Gruppe von Menschen bei Gruppenarbeit in Bibliothek (Bild generiert mit ChatGPT, 2024 – https://chat.openai.com)
Citizen Science – die aktive Einbindung von Laien in Forschungsprojekte – ist nicht nur ein moderner Ansatz, sondern ein revolutionärer Schritt, der die Wissenschaft von innen heraus transformieren kann. Hier sind acht Gründe, warum Sie jetzt mit Citizen Science beginnen sollten.
1. Den Elfenbeinturm verlassen: Wissenschaft durch Partizipation demokratisieren
Citizen Science ist eine Chance, die Grenzen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu überwinden. Indem Sie Bürgerinnen und Bürger aktiv in Ihre Forschung einbeziehen, schaffen Sie Transparenz und ermöglichen einen offenen Zugang zu wissenschaftlichen Prozessen. (vgl. BMBF (2023): Partizipationsstrategie Forschung. URL: https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2023/partizipationsstrategie.html [18.09.2024])
2. Gemeinschaft stärken: Demokratie braucht gruppenübergreifendes Forschen
Eine funktionierende Demokratie lebt von Teilhabe und Begegnung. Citizen Science fördert genau das, indem es Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und Regionen zusammenbringt. Mit Citizen Science schaffen Sie Räume für gruppenübergreifendes Forschen und ermöglichen Interessierten, aktiv an wissenschaftlichen Projekten zu partizipieren. (vgl. zum Thema Begegnung im Alltag: Manthe, Rainald (2024): Demokratie fehlt Begegnung. Über Alltagsorte des sozialen Zusammenhalts. Bielefeld: transcript. DOI: https://doi.org/10.1515/9783839471418)
3. Wissenschaftskommunikation verbessern: in den Dialog treten
Citizen Science ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Wissenschaftskommunikation. Indem gemeinsam mit Laien der Wissenschaftsprozess aufbereitet wird, entsteht ein Dialog, in dem die Bedeutung und der Nutzen wissenschaftlicher Erkenntnisse sichtbar werden. Dies trägt dazu bei, das Verständnis für wissenschaftliche Methoden zu fördern und das oft vorhandene Misstrauen gegenüber der Forschung zu verringern. (zum dialogischen Forschungsprozess: Bogusz, Tanja (2020): Kollaboratives Forschen. In: Selke, Stefan et al.: Handbuch Öffentliche Soziologie. Öffentliche Wissenschaft und gesellschaftlicher Wandel. Wiesbaden: Springer VS. DOI: doi.org/10.1007/978-3-658-16995-4)
4. Einfach Daten sammeln (lassen): Ressourcen nutzen
Ein sichtbarer Vorteil von Citizen Science ist die Möglichkeit, Daten auf einfache und kostengünstige Weise gemeinsam zu sammeln. Ob es um Umweltbeobachtungen, historische Dokumentationen oder die Anreicherung großer Datensätze geht – Citizen Science erweitert Ihre Reichweite und ermöglicht es Ihnen, Daten zu sammeln, die allein schwer zugänglich oder zu aufwändig wären. (siehe jedoch kritisch zu Datenmanagementkompetenzen von Citzen Scientists: O’Grady, M. & Mangina, E. (2024): Citizen scientists—practices, observations, and experience. In: Humanities and Social Sciences Communications. Vol. 11, DOI: doi.org/10.1057/s41599-024-02966-x)
5. Fördergelder einwerben: Partizipation als Pluspunkt beim Antrag
Förderinstitutionen legen immer mehr Wert auf partizipative Ansätze in der Wissenschaft. Der Nachweis, dass Ihre Forschung nicht nur für die wissenschaftliche Community, sondern auch für die Öffentlichkeit von Bedeutung ist, erhöht Ihre Erfolgschancen bei der Einwerbung von Mitteln deutlich. (vgl. Wissenschaft im Dialog gGmbH (2024): mit:forschen! Gemeinsam Wissen schaffen: Förderinstrumente. URL: https://www.mitforschen.org/citizen-science/handbuch/foerderinstrumente [18.09.2024])
6. Mehr machen als (offene) Wissenschaft verwalten: Kreativität und Diskussion in den Mittelpunkt der Forschung stellen
Die zunehmende Bürokratisierung in der Wissenschaft führt oft dazu, dass Forscher mehr Zeit mit der Verwaltung von Projekten als mit dem eigentlichen Forschen verbringen. Bei Citizen Science geht es auch darum, durch sinnvolle Vernetzung wieder in den kreativen Prozess einzutauchen und Forschung zu diskutieren. (vgl. Leonelli, Sabina (2023): Philosophy of Open Science. Cambridge: Cambridge University Press, S. 67-68. DOI: doi.org/10.1017/9781009416368)
7. Neue Erkenntnisse gewinnen: Durch vielfältige Perspektiven
Freiwillige, die sich an wissenschaftlichen Projekten beteiligen, bringen oft neue, unerwartete Perspektiven und lokales Wissen ein. Dieser frische Blickwinkel kann zu innovativen Erkenntnissen führen, die in rein akademischen Projekten möglicherweise nicht auftauchen würden. (vgl. auch das Konzept der Open Innovation in den Wirtschaftswissenschaften: Pohl, Alexander & Engel, Berit (2021): Open Innovation. Systematische Darstellung des State of the Art auf Basis einer Zitationsanalyse. In: CENTIM Working Papers. No. 2. Rheinbach: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. DOI: doi.org/10.18418/978-3-96043-092-6)
8. Aktuelle Forschungsfragen entwickeln: Forschung mit gesellschaftlicher Relevanz
Indem Sie Bürgerinnen und Bürger in Ihre Forschung einbinden, können Sie relevante und praxisnahe Forschungsfragen entwickeln, die an den tatsächlichen Bedürfnissen und Herausforderungen der Gesellschaft anknüpfen. So können Sie Forschung betreiben, die nicht nur auf akademischer Ebene von Interesse ist, sondern auch konkrete Probleme löst und den Alltag der Menschen verbessert. (als Beispiel: Overgaard, Anne Kathrine & Kaarsted, Thomas (2018): A New Trend in Media and Library Collaboration within Citizen Science? The Case of ‘A Healthier Funen’. In: Liber Quarterly. Vol. 28. DOI: doi.org/10.18352/LQ.10248)
Fazit: Citizen Science als Weg zur zukunftsorientierten Forschung
Citizen Science ist mehr als nur ein neuer Trend – es ist eine transformative Bewegung, die die Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben wird, grundlegend verändert. Indem Sie Hobby-Forscherinnen und -Forscher in Ihre Projekte einbinden, schaffen Sie nicht nur mehr Transparenz und Teilhabe, sondern tragen auch zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen bei. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit Citizen Science neue Wege zu gehen.
————————–
Aktuelle Informationen, beispielsweise zu Förderinstrumenten, Datenmanagement in Projekten sowie rechtlichen und ethischen Fragen, werden auf diesen zentralen Plattformen zusammengetragen:
Unterstützung erwünscht?
Nehmen Sie Kontakt zum Open Science Team der Universitätsbibliothek auf:
Davide Del Duca: davide.del-duca@bibliothek.tu-chemnitz.de | Telefon: +49 371 531-36501 | Chat/Matrix: https://matrix.to/#/@dadel:tu-chemnitz.de
Martina Jackenkroll: martina.jackenkroll@bibliothek.tu-chemnitz.de | +49 371 531-33482
(Formuliert mit Unterstützung von ChatGPT.)